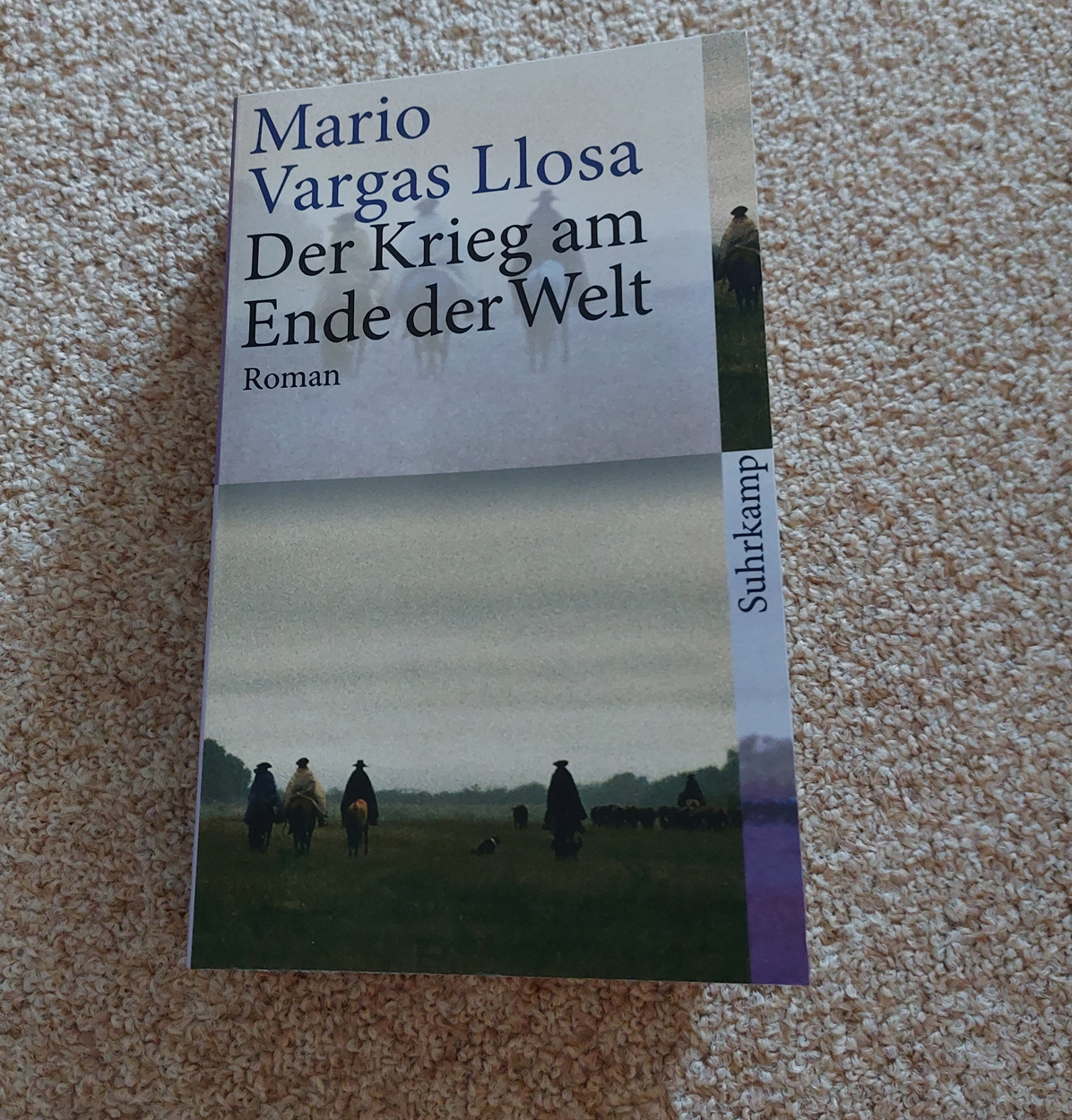Brasilien, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Monarchie ist abgeschafft, die junge Republik versucht, sich zu konsolidieren. Ein Wanderprediger, Ratgeber genannt, zieht durch die von Hungersnöten, Seuchen und chronischer Armut geplagten Gegenden und verkündet das Ende der Welt. Eine Schar von Ausgestoßenen, der Ärmsten im Lande, sammelt sich um ihn, fest entschlossen, den wahren Glauben gegen den Antichrist zu verteidigen, der die Menschheit verderben will. Dieser Antichrist ist – die Republik.
Sie gründen in Canudos die „Gesellschaft der Ärmsten“, ein „neues Jerusalem“. Mit Brüderlichkeit und Solidarität wollen sie Widerstand leisten. Die Aufständischen haben jedoch alle gegen sich: die um ihre Autorität besorgte Kirche, einen patriarchalischen Feudalherrn, zwei um die eigene Macht kämpfende Republikaner, den Revolutionär Galileo Gall. Sie alle reagieren mit Angst auf die Gründung des »neuen Jerusalems«. Die gesamten brasilianischen Streitkräfte werden schließlich aufgeboten, um die Anhänger des Ratgebers zu vernichten. (Klappentext)
„Der Krieg am anderen Ende der Welt“ – meine Art zu lesen
Der Roman veranlasste mich, tiefer in das Thema einzusteigen und gewisse Recherchen zu betreiben, den Aufstand in Canudos, betreffend.
Ich finde, es reicht nicht, wie ich das oftmals lese, einfach zu sagen: Schön geschrieben, ein Buch für den Urlaub. Nein, ganz und gar nicht. Ich würde es als schwer verdauliche Kost beschreiben, geschrieben in einer faszinierenden Art Mosaik – verschieden Sichtweisen, verschiedene Blickwinkel unterschiedlichster Menschen, die auf dieselben Szenen schauen. Daraus ergibt sich, wie bei einem großen Mosaik oder einem Puzzle ein lebendiges, farbenfrohes Gemälde, das eine meterlange Wand bedeckt, an der neugierige Betrachter entlanglaufen können und damit die ganze Geschichte erfahren.
Geschichte und Roman
Es ist, wie schon angedeutet, unerlässlich, entweder diesen geschichtlichen Teil Brasiliens zu kennen, oder sich damit auseinanderzusetzen, um den Roman besser verstehen zu können.
Gegen Ende des Jahres 1889 führte ein Staatsstreich in Brasilien zum Sturz des damaligen Kaisers Pedro und zur Gründung der ersten Republik Brasiliens. Die neue Republik versuchte, modernere Lebensweisen zu etablieren, neue Gesetze durchzusetzen. Dabei ging es beispielsweise um folgende Punkte:
• staatliche Eheschließungen – bisher gab es nur die traditionellen Eheschließungen, die vor Gott beschlossen wurden
• Einführung von metrischen Systemen (Maßeinheiten)
• Errichtung staatlicher Friedhöfe
• Steuern – der Landbevölkerung war teilweise gar nicht klar, was das ist, geschweige denn, wofür Steuern gut sein sollten
• Es sollten Einwohnerzählungen mit Angaben der Hautfarbe und der Rassenzugehörigkeit durchgeführt werden. – Ehemalige Sklaven fürchteten dadurch eine erneute Versklavung.
Diese Punkte brachte vor allem die Landbevölkerung gegen die neue Republik auf. Es kollidierte zu sehr mit ihrer Realität.
In dieser Zeit gab es einige Wanderprediger, die durch das Land pilgerten. Einer war Antonio Vicente Mendes Maciel, genannt Conselheiro (der Ratgeber). Dieser Mann wird in Vargas Llosas Roman zu einer der tragenden Figuren, das war er auch in der Wirklichkeit. Seine Predigten, seine Lebensweisheiten zogen immer mehr Menschen an. Dadurch gründete sich in der Provinz Bahia um 1893 eine Siedlung – Belo Monte (etwa 20 Kilometer vom heutigen Canudos entfernt).
Hier steigt der Roman ein. Canudos liegt von der damaligen Zentralregierung rund 1400 Kilometer entfernt, hinter unwegsamem Gelände, in einer Steinwüste. Die Siedlung ist also nur unter größten abenteuerlichen Bedingungen und Entbehrungen für Mensch und Tier erreichbar.
Die neue Regierung sah in der Siedlung und dem dort herrschenden Drang, keinem der neuen Gesetze zu folgen, einen Grund, ein Exempel an denen zu statuieren, die an komplett anderen Lebensweisen festhielten. In dieser Gemeinschaft lebte man ohne Geld – jeder nahm das, was er brauchte und teilte mit seinem Nächsten. Die Einwohner arbeiteten hart in der unwirtlichen Gegend. Sie trieben Wasserkanäle in den steinernen Boden, bauten Mais, Bohnen, Melonen an, versuchten, Schafe und Ziegen zu züchten.
Das alles konnte in den Augen der neuen Republik nicht so weitergehen. Es gab insgesamt vier militärische Expeditionen. Das Ergebnis: Kein einziger männlicher Einwohner der Siedlung überlebte – sie wurden regelrecht abgeschlachtet. Von rund 20000 Einwohnern überlebten etwa 400 Frauen und Kinder, die nach dem Gemetzel meistbietend in die Sklaverei verkauft wurden.
Der Roman ist in vier Teile aufgeteilt. Jeder Teil steht für den Angriff staatlicher Mächte auf die anders denkende Bevölkerung in Canudos.
Der Text lässt sich, natürlich im Hinblick auf die Ereignisse in der Welt bis zur Entstehung des Romanes (1981 erstmals erschienen) und darüber hinaus, entsprechend interpretieren. Ich finde, „Der Krieg am anderen Ende der Welt“ gehört als Grundlage für gewisse Themen in unseren Schulen behandelt und gelesen.
Links
Ausführliches zum Aufstand in Canudos fand ich unter anderem auf dieser Webseite: www.bauernkriege.de/canudos.html
„Der Krieg am anderen Ende der Welt“ bei wikipedia
Buchdaten
• ISBN: 978 3 518 37843 4 (12. Auflage 2023)
• Verlag: Suhrkamp
• Aus dem Spanischen von Anneliese Botond